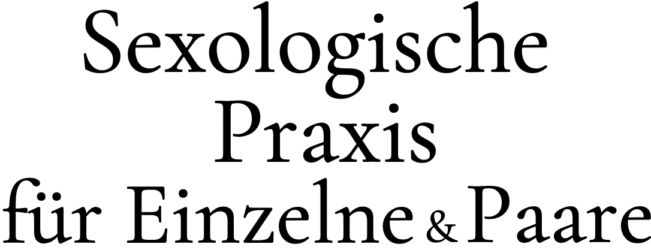Wenn alles möglich ist, aber nichts mehr unter die Haut geht
Noch nie wurde so differenziert und zugleich so offen über Sexualität gesprochen. Noch nie war das Repertoire an Begriffen und Methoden so umfangreich, die Haltung so reflektiert, der Anspruch so hoch. Noch nie stand uns ein so reichhaltiges Vokabular für Lust, Konsens und Körperlichkeit zur Verfügung.
Wir haben uns von den schamhaften Flüstertönen der Vergangenheit zu einer aufgeklärten Gesellschaft entwickelt, die ein buntes, vielfältiges, neonleuchtendes Vokabular der Sexualität – oder besser: der Sexualitäten – geschaffen hat. In Podcasts, Instagram-Reels und auf Panels wird gesprochen, analysiert, diskutiert. Und die Namen vieler Workshops in diesem Bereich klingen wie Cocktails in einer hippen Bar: Feuer der Lust – das Extase-Retreat, Kinky-Kuss-Workshop, Wheel-of-Konsent-Training, Yoni-Watching, Conscious-Tempelnight.
Ja, diese Entwicklung ist ein Geschenk. Sie befreit uns vom Schweigen und vom Tabu. Sie öffnet Räume, in denen Menschen sich ausdrücken, ihre Grenzen benennen und ihre Sehnsüchte teilen können. Ich erlebe in meiner Praxis immer wieder, wie transformierend es sein kann, endlich Worte zu finden für etwas, das lange nur als diffuses Gefühl existierte. Sprache schafft Bewusstsein und aus Bewusstsein entsteht Klarheit. Doch Sprache und die damit einhergehende Deutlichkeit können dem Sex auch seine Magie nehmen. Das Mysterium, das ihm innewohnt, kann durch zu viele Worte, zu viel Bewusstsein überlagert werden.
So spüre ich in meiner Arbeit mit Paaren und Einzelnen eine leise Verschiebung. Neben der neu gewonnenen Freiheit taucht eine andere Erfahrung auf: eine Form von Müdigkeit, die sich schwer greifen lässt. Menschen sagen: „Wir machen doch alles richtig, und doch fühlt es sich nicht wirklich lebendig an.“ Oder: „Ich weiß so viel über Sexualität – und doch spüre ich so wenig.“
Diese Erfahrungen beschreiben, was ich Sexuelle Fatigue nenne: eine Erschöpfung, die nicht aus Mangel entsteht, sondern aus Überfülle.
Sexualität ist heute weniger Tabu als Projekt. In meiner Praxis begegnen mir Menschen, die sich mit großer Ernsthaftigkeit aufmachen, gute Liebhaber*innen zu werden, ihre Lust zu verstehen, sich der eigenen Sinnlichkeit anzunähern. Als Sexologin begrüße ich das sehr. Ich beobachte aber auch, dass dies oft mit der Disziplin eines Trainings zur Kompetenzsteigerung geschieht. Die eigene Sexualität wird analysiert und optimiert, ähnlich wie andere Lebensbereiche.
Menschen beschäftigen sich eingehend mit der Anatomie ihrer Geschlechtsteile, besuchen Kuss-Workshops und Tantramassage-Seminare, üben Konsent und Kommunikationstechniken, probieren Methoden und Settings aus, um herauszufinden, was sich für sie stimmig anfühlt. All das kann klärend, stärkend und befreiend sein. Doch manchmal entsteht dabei eine paradoxe Leere. Wenn alles besprochen, alles verstanden, alles ausprobiert ist, bleibt wenig Raum für das Unvorhersehbare.
Denn es gibt eine Ebene der menschlichen Sexualität, die sich all dem entzieht: la Erótica! Erotik ist das Mysterium, das dem Sex seine Magie verleiht, jene schwer greifbare Dimension, die sich nicht planen, nicht garantieren und nicht vollständig erklären lässt.
Erotik lebt eben nicht von Eindeutigkeit. Sie entsteht in einem feinen Schwebezustand, zwischen Wissen und Geheimnis, zwischen dem, was wir bewusst gestalten, und dem, was sich doch unserer Kontrolle verweigert. Sie gleicht einem Tanz im Halbdunkel, sichtbar und hell, dunkel und unsichtbar zugleich. Wenn wir uns zu sehr auf die Technik konzentrieren, entgleitet sie uns.
Wir können vieles vorbereiten: den Raum gestalten, das Licht dimmen, Duftkerzen anzünden, Dessous und Sextoys bereitlegen, Grenzen besprechen, ein Ritual schaffen. Doch all das bleibt nur die Bühne. Der eigentliche Moment, in dem etwas in uns zu kribbeln und schwingen beginnt, bleibt nebulös. Denn Erotik lässt sich nicht produzieren, nur einladen. Wir können offen sein für das Spiel oder uns ihm verschließen. Es ist ein wenig wie beim Besuch einer Oper oder eines Museums: Wir können uns entscheiden, aufmerksam zuzuhören, hinzusehen, uns neugierig einzulassen. Doch wir wissen nicht, ob uns eine bestimmte Arie Tränen in die Augen treibt oder ein Bild uns bis ins Mark berührt. Wir können uns nur in Präsenz üben, empfänglich sein, uns berühren lassen. So können wir uns für einen Augenblick im Erleben verlieren. Die Philosophin Simone Weil beschrieb diese Selbstvergessenheit als ein Aufgehen in der Erfahrung, in dem das Ich leiser wird und Platz macht für etwas Größeres, das über uns hinausweist. Es ist kein Kontrollverlust, sondern eine Art stiller Freiheit, die uns erlaubt, ganz da zu sein, ohne uns ständig selbst zu beobachten. In einer Kultur, die von Selbstoptimierung und Selbstreflexion geprägt ist, wird genau diese Fähigkeit selten geübt und doch bleibt sie ein tiefes menschliches Bedürfnis.
Hier offenbart sich ein Dilemma unserer Zeit: Wir wünschen uns maximale Sicherheit und zugleich prickelnde Sensationen. Wir wollen frei sein und uns zugleich geschützt fühlen. Diese Ambivalenz gehört zum Menschsein. Doch wenn Kontrolle zur obersten Maxime wird, erstickt sie das Unerwartete, das Spielerische, das Geheimnisvolle. Das Bedürfnis nach Kontrolle hat auch mit der Welt zu tun, in der wir leben. Sie ist laut, fragmentiert, voller Widersprüche. Globale Krisen, digitale Beschleunigung, gesellschaftliche Brüche, all das lässt uns nach Halt und Sicherheit suchen. Sexualität und partnerschaftliche Intimität werden so zu einem Bereich, den wir wenigstens scheinbar in unseren Händen halten. Doch der Versuch, das Unverfügbare zu bändigen, erstickt genau das, was wir am meisten suchen: Nähe, die uns wirklich berührt.
In sexpositiven Räumen zeigt sich dieses Spannungsfeld besonders deutlich. Hier wird Intimität oft bis ins kleinste Detail verhandelt: „Küssen ja, Kratzen sanft, Hände dort, nicht dort.“ Berührungen folgen einem klaren Skript, Nähe wird sorgfältig inszeniert, fast wie eine künstlerische Choreografie. Dadurch wird Sexualität nicht nur reflektierend kultiviert, sondern zunehmend auch technisiert. Nicht nur durch Apps, Toys und digitale Tools, sondern durch die Art und Weise, wie Begegnungen Schritt für Schritt strukturiert werden: Grenzen werden markiert, Absprachen präzisiert, alles soll möglichst optimal gelingen: Handschuhe an, Gleitgel bereit, erlernte Technik angewandt, alles korrekt, alles bedacht. Sicher, klar und doch manchmal seltsam kühl. Konsenttechniken sind eine große Errungenschaft, doch wenn nur noch gesprochen und weniger erspürt wird, verliert sich die Sinnlichkeit in Regeln. Denn Sexualität und Erotik sind mehr als Techniken, mehr als Konsensformeln, mehr als perfekte Abläufe. Sie sind ein Möglichkeitsraum, in dem wir uns selbst begegnen können, jenseits der Bilder, die wir gelernt haben.
Die Künstlerin Anna Natt hat dem Gefühl der sexuellen Fatigue eine radikale Form gegeben. In ihrer Performance The Bore_gy inszeniert sie nicht Ekstase, sondern Langeweile. Die Teilnehmenden wiederholen monotone Bewegungen, verweigern jede Steigerung. Kein Spektakel, keine Höhepunkte, nur Leerlauf. Diese „Orgie der Monotonie“ wirkt wie eine Entgiftung von der ständigen Erwartung, dass Sexualität immer aufregender, intensiver, perfekter werden müsse. Sie macht sichtbar, was viele im Privaten erleben: Müdigkeit, die aus der Überfülle des Möglichen entsteht.
Vielleicht liegt im Kern der sexuellen Fatigue auch etwas Tröstliches. Nicht alles, was möglich ist, muss auch erlebt werden. Die Vielfalt, die einst Befreiung versprach, kann zur Last werden, wenn sie zum Anspruch wird. Menschen fühlen sich erschöpft von der ständigen Aufforderung, ihre Sexualität zu perfektionieren, zu steigern, zu optimieren. Aus Lust wird Leistung. Aus Neugier eine Checkliste, die fleißig abgearbeitet wird.
In meiner Praxis nehme ich eine, wie ich finde, gesunde Sehnsucht nach Augenblicken der Selbstvergessenheit wahr: nach Erfahrungen, in denen das eigene Ich nicht im Vordergrund steht, sich das ständige Bewerten und Planen auflöst und ein Raum entsteht, in dem wir einfach sind: berührt, beseelt, verbunden, uns verströmend. Diese Form der Hingabe steht im Kontrast zu einer Kultur, die uns lehrt, uns selbst ständig zu beobachten und zu optimieren. Sie erinnert uns daran, dass Erotik nicht nur im Tun liegt, sondern auch im Sein. Und dass wir manchmal mehr finden, wenn wir aufhören zu suchen.
Es ist an der Zeit, eine andere Perspektive einzunehmen: Sexualität und Erotik nicht nur als zu erlernende Fähigkeiten zu betrachten, sondern als lebendigen Prozess, der Offenheit verlangt. Ein Prozess, der Widersprüche aushält. Der nicht immer funktioniert und gerade deshalb lebendig ist. Vielleicht beginnt Erotische Sexualität dort, wo wir aufhören, etwas richtig machen zu wollen und uns stattdessen mehr überraschen lassen. Genau hier kann eine neue Form von warmer Nähe entstehen: eine, die sich nicht über Reizintensität definiert, sondern über Resonanz. Eine Nähe, die nicht aus dem Wunsch entsteht, besonders gut zu performen, sondern aus dem Wunsch, wirklich in Beziehung zu treten – mit sich, mit dem Anderen, mit dem Leben.